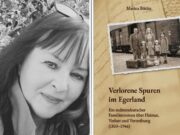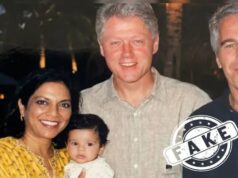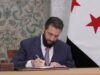Von Dr. Michael Reinhard Heß
Mehr als zwei Jahre nach dem Ende des Karabachkonflikts arbeiten Aserbaidschan und Armenien gemeinsam an einem Friedensplan und bereiten die Normalisierung der Beziehungen vor.
Im Rahmen der Initiative „Friedensbrücke“ trafen fünf armenische Vertreter (die bisweilen als Experten, bisweilen als NGO-Vertreter gelabelt werden) in Baku ein und diskutierten mit aserbaidschanischen Kollegen über den Stand der Dinge zwischen Armenien und Aserbaidschan.
Wer hätte vor sechs Jahren gedacht, dass dies heute möglich sein könnte? Der unten verlinkte Artikel mit einem aktuellen Interview des aserbaidschanischen Parlamentsabgeordneten Dr. Rizvan Nabiyev ordnet diesen Prozess aus aserbaidschanischer Sicht ein.
Unabhängig vom weiteren Gang der Entwicklungen bieten die politischen Geschehnisse im Südkaukasus in den letzten fünf Jahren reichlich Stoff für Politiktheorieinteressierte auch außerhalb der Region.
Der Umstand, dass es Aserbaidschans Führung durch ein beherztes militärisches Vorgehen gelungen ist, eine illegale separatistische und terroristische Bedrohung ein für alle Male zu beseitigen und dadurch einen faktischen Friedensprozess in Gang zu setzen, nachdem dreißig Jahre Verhandlung beziehungsweise Verhandlungssimulation (also Verhandlung ohne wirkliche Absicht, etwas zu tun), etwa durch die in diesem Jahr aufgelöste Minsk-Gruppe der OSZE, gar nichts bewirkt hatten, ist eine theoretische Herausforderung für alle, die (etwa in Bezug auf Russlands verbrecherischen Krieg in der Ukraine) das Mantra vor sich hertragen, Verhandlungen seien immer die einzige oder die beste Lösung.
Der Befehl eines – auch noch autoritär regierenden – Staatsoberhaupts setzte dem Separatismus in Aserbaidschan erfolgreich ein Ende und schützte damit die Souveränität des Landes.
Die Wurzeln dieses Separatismus lagen jedoch zu einem erheblichen Teil in zivilgesellschaftlichen und sich auf demokratische Traditionen berufenden Bestrebungen, darunter die Entwicklung von Großreich- und ethnischen Reinheitsphantasien durch sowjetisch-armenische Intellektuelle vor 1987 sowie Petitionen, Meetings, Pressekampagnen und Beeinflussungsaktionen der armenischen nationalistischen Lobby zwischen 1987 und 1991.
Dieser Umstand stellt eine ernsthafte Herausforderung für all jene dar, die glauben, dass unter demokratischen Vorzeichen auftretende Bewegungen a) grundsätzlich gut seien und b) nur mit denselben demokratischen Mitteln bekämpft werden dürften und könnten.
Meiner Meinung nach ist es ein tödlicher Irrtum, staatliche oder nichtstaatliche Akteure, deren prinzipielles und erklärtes Ziel die Zerstörung oder Unterwanderung eines fremden Staates ist, so zu behandeln, als seien sie nur Teile des politischen Systems des von ihnen angegriffenen Staates oder wollten oder könnten nur dies sein.
Anhänger dieser Meinung behaupten etwa, man könne sich mit Putins Russland oder mit der AfD arrangieren, wenn man ihnen bestimmte Konzessionen mache. Bisher war immer das Gegenteil der Fall: Je mehr man den Feinden der Demokratie entgegenkommt, desto stärker intensivieren sie ihren Kampf gegen sie. Dass die AfD unsere demokratische Ordnung ablehnt und bekämpft, ist erwiesen. Dass Putins Verbrechersystem nur sich selbst huldigt, auch.
Der Blick Aserbaidschans auf den armenischen Separatismus war niemals von jener Naivität geprägt, die etwa viele Deutsche bis heute im Umgang mit der Bedrohung durch die AfD oder Russland prägt. Zu den Gründen gehört, dass Aserbaidschan auf über ein Jahrhundert leid- und schmerzvolle Erfahrung mit den Folgen armenisch-chauvinistischen Denkens zurückblicken kann.
Bei vielen in Deutschland herrscht dagegen die Vorstellung, dass mit der Sieg über den Nationalsozialismus im Jahr 1945 sowohl die Gefahr seines Wiederauftretens (wenn auch mit einer anderen Farbe) als auch die Gefahr, selber Opfer fremder imperialistischer Aggression zu werden, gewissermaßen ein für allemal gebannt sei. Als sei die Weltordnung nach 1945 gewissermaßen geheilt worden, als sei „Nie wieder“ eine Konstatierung und gleichbedeutend mit „Alles ist besser geworden“.
Indem wir Deutschen uns selber das, wie man heute sieht, mehr als fragliche Attest ausstellten, aus der Geschichte gelernt zu haben, sind wir nicht nur blind geworden für unsere eigene Tendenz zur Wiederauflage von längst vergangen geglaubtem Übel, sondern auch für die tatsächliche Gefahr von außen.
(Quelle)
ZUM AUTOR

PD Dr. Michael Reinhard Heß, geboren in Offenbach am Main, ist ein renommierter Turkologe, der an der Universität Frankfurt am Main Geschichte, Turkologie, Islamkunde und Griechische Philologie studierte. Nach seiner Promotion und Habilitation wirkt er seit 2005 als Privatdozent für Turkologie an der Freien Universität Berlin und hat über 130 wissenschaftliche Arbeiten verfasst, darunter Beiträge zur türkischen Literatur und Kulturgeschichte. Als Übersetzer und Gründer des Verlags Gulandot widmet er sich der Förderung türkischer Literatur in deutscher Sprache, etwa durch Werke zu Imadeddin Nasimi oder der kulturellen Bedeutung von Schuscha.
AUCH INTERESSANT
– Bergkarabach-Krise –
Turkologe Heß: Was passiert in Karabach?
Der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um die damalige „Autonome Region Berg-Karabach“ (NKAO) brach Ende 1987 aus und weitete sich nach dem Zerfall der Sowjetunion zu einem vollumfänglichen Krieg aus.