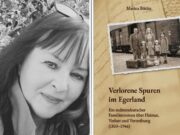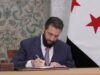Ein Gastbeitrag von Özgür Çelik
Erdoğans USA-Besuch und sein Treffen mit Trump haben deutlich gezeigt, in welchem Rahmen die türkische Außenpolitik gehalten wird.
Die kritischste Aussage des Treffens kam von Tom Barrack: „Wir geben Legitimität.“ Dieser Satz bedeutet, dass der Türkei symbolisch erlaubt wird, nicht vollständig aus dem internationalen Spiel ausgeschlossen zu werden.
Doch diese Erlaubnis ist keine Anerkennung unabhängiger Entscheidungen – sondern nur das Recht, nach den Regeln anderer weiterhin am Tisch zu sitzen. Mit anderen Worten: Man ist am Tisch, aber nicht derjenige, der die Spielregeln bestimmt.
Trumps Äußerung zur Energiepolitik verdeutlicht dieses Bild noch stärker. Das Angebot an Ankara, „Kaufe kein Öl und Gas von Russland, kaufe von mir“, war kein ökonomisches, sondern ein geopolitisches Druckmittel.
Die Energieabhängigkeit von Russland war bisher einer der wichtigsten strategischen Trümpfe der Türkei. Wenn diese Verbindung gekappt wird, verwandelt sich die Türkei in eine Energie-Durchgangsstation für die europäischen Verbündeten der USA. Doch was bekommt Ankara im Gegenzug? Konkrete Gewinne? Investitionen? Technologie? Oder nur eine symbolische Zustimmung?
Die Signale für neue Abhängigkeiten sind längst sichtbar. Die von BOTAŞ mit internationalen Energiekonzernen abgeschlossenen LNG-Verträge und langfristigen Kontrakte öffnen nicht die Tür zu mehr Diversifizierung, sondern zu einer neuen Form der Abhängigkeit.
Mit dem steigenden LNG-Import aus den USA wird auch die Zukunft strategischer Projekte mit Russland – wie das Akkuyu-Atomkraftwerk – infrage gestellt. Wird die wichtigste Energieinvestition der Türkei unter diesem außenpolitischen Druck in eine ungewisse Zukunft gedrängt?
Mega-Deal mit Boeing
Ein weiteres bemerkenswertes Ergebnis des Besuchs zeigte sich in der Luftfahrtbranche. Turkish Airlines hat bei Boeing 75 Dreamliner bestellt (50 fest, 25 als Option) und zudem Verhandlungen über 150 Stück des Typs 737-MAX aufgenommen.
Damit entsteht für die nächsten zehn Jahre eine milliardenschwere Abhängigkeit. Die Auslieferungen sollen zwischen 2029 und 2034 erfolgen. Doch wie wird diese langfristige Abhängigkeit bewältigt, wenn morgen eine politische Krise ausbricht? Wird sie nicht zum Druckmittel der USA?
All diesen Entwicklungen liegt ein inneres Problem zugrunde: der Verlust an innerer Legitimität. Der nach dem 15. Juli verhängte Ausnahmezustand, die Säuberungen in Medien und Wissenschaft, die Schwächung der Unabhängigkeit der Justiz – all das hat die Demokratie in der Türkei beschädigt.
Da die notwendige Legitimität im Inneren nicht mehr ausreichend von der Bevölkerung bezogen werden konnte, wurde die Suche nach externer „Legitimität“ unvermeidlich. Doch der Preis dieser äußeren Legitimität ist hoch.
Wir haben es in der Brunson-Krise gesehen: Trump sagte offen, „Ich habe es verlangt, Erdoğan hat ihn freigelassen.“ Wir haben es in der S-400-Frage gesehen: Die Türkei wurde aus dem F-35-Programm ausgeschlossen, Sanktionen standen im Raum. Und nun erleben wir ähnliche Zugeständnisse in Energie- und Wirtschaftsfragen.
Hier stellen sich einfache, aber entscheidende Fragen: Wird echte Legitimität durch symbolische Bestätigungen von außen erlangt – oder durch den freien Willen des Volkes und starke Institutionen im Inneren?
Welche Zukunft haben strategische Energieprojekte mit Russland wie das Akkuyu-Kraftwerk unter dem Druck der USA? Machen die neuen BOTAŞ-Verträge die Türkei nicht noch abhängiger? Und wenn die Boeing-Bestellungen eines Tages zum Gegenstand politischer Erpressung werden – welche Optionen bleiben dann noch?
Das heutige Bild ist eindeutig: Die von den USA gewährte Legitimität ist keine Partnerschaft auf Augenhöhe, sondern eine bedingte Zustimmung. Die Zugeständnisse der Türkei sind groß, der Gegenwert dagegen meist symbolisch.
Das betrifft nicht nur die außenpolitische Unabhängigkeit, sondern wirkt sich direkt auf den Wohlstand der Bevölkerung aus. Die entscheidende Frage bleibt: Wird die Türkei ihre Legitimität weiterhin durch äußere Zustimmung sichern – oder auf die eigene Bevölkerung bauen und zu einem wirklich unabhängigen und starken Land werden?
Gastbeiträge geben die Meinung der Autoren wieder und stellen nicht zwingenderweise den Standpunkt von NEX24 dar.
Zum Autor
 Özgür Çelik studierte Politikwissenschaft, Soziologie und Philosophie an der Universität Duisburg-Essen. Seine Fachgebiete sind die deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sowie zwischen der EU und der Türkei, türkische Politik, die türkische Migration und Diaspora in Deutschland
Özgür Çelik studierte Politikwissenschaft, Soziologie und Philosophie an der Universität Duisburg-Essen. Seine Fachgebiete sind die deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sowie zwischen der EU und der Türkei, türkische Politik, die türkische Migration und Diaspora in Deutschland
AUCH INTERESSANT
– Gastkommentar –
Weltordnung: „Türkei muss Rolle selbstbewusst gestalten“
Çelik. „Nach dem Ende des Kalten Krieges herrschten im Westen zahlreiche Illusionen. Man glaubte, die Globalisierung werde automatisch Demokratie hervorbringen.“