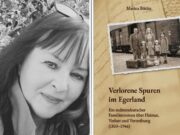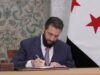Ein Gastbeitrag von Çağıl Çayır
Als 1949 das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verabschiedet wurde, stand Deutschland an einem historischen Wendepunkt.
Nach dem Zivilisationsbruch des Nationalsozialismus musste eine neue Ordnung geschaffen werden, die sowohl Lehren aus der Vergangenheit zog als auch Zukunft versprach. Zwei Begriffe ragen aus diesem Dokument heraus: Gott und die Menschenwürde.
„In Verantwortung vor Gott und den Menschen“
Die Präambel des Grundgesetzes ruft Gott an – nicht als theologischen Dogmatismus, sondern als eine Quelle von Verantwortung.
Dieser Gottesbezug sollte zeigen: Staatliche Macht ist nicht absolut. Sie steht unter einem höheren Anspruch, sei es religiös verstanden oder als Symbol für das Gewissen und die Grenzen menschlicher Verfügungsgewalt.
Artikel 1: Die Würde des Menschen
Gleich im ersten Artikel wird festgeschrieben:
„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“
Damit wurde ein fundamentaler Gegensatz zum totalitären Denken der NS-Diktatur gezogen. Der Mensch darf niemals wieder zum Objekt degradiert werden – weder von der Politik noch von der Gesellschaft.
Gott und Würde – zwei getrennte, aber verwandte Ebenen
Die Väter und Mütter des Grundgesetzes verbanden den Gottesbezug nicht zwingend mit einer bestimmten Konfession. Für gläubige Menschen verweist er auf den Schöpfer, in dessen Ebenbild der Mensch geschaffen ist.
Für säkulare Leser kann er als Hinweis verstanden werden, dass Menschenwürde nicht von staatlichen Mehrheiten oder Machtinteressen abhängig ist, sondern einen überpositiven, unverfügbaren Rang besitzt.
Menschenwürde als säkularer „heiliges Gut“
So gesehen übernimmt die Menschenwürde im Grundgesetz eine Funktion, die traditionell Religionen erfüllten: Sie ist das unantastbare Fundament, auf dem alle anderen Rechte und Freiheiten ruhen.
Auch wer nicht an Gott glaubt, muss akzeptieren, dass die Würde des Menschen außerhalb staatlicher Willkür steht – fast wie ein „säkulares Heiliges“.
Ein offener Konsens
Die doppelte Verankerung – Verantwortung vor Gott und Schutz der Menschenwürde – ermöglicht es, dass Gläubige wie Nichtgläubige denselben Verfassungstext bejahen können.
Für die einen ist Gott der Ursprung dieser Würde, für die anderen ist die Würde selbst das höchste Prinzip. In dieser Spannung liegt eine Stärke: Sie verbindet Menschen über religiöse und weltanschauliche Grenzen hinweg.
Das Grundgesetz stellt klar: Keine Macht auf Erden darf die Würde des Menschen verletzen. Ob man den Gottesbezug als Glaubensbekenntnis liest oder als Symbol für eine höhere Verantwortung – er verweist darauf, dass Freiheit und Würde nicht aus der Hand des Staates stammen, sondern vorstaatlich, unverfügbar und universal sind.
Schlussgedanke
Dabei darf nicht übersehen werden: Der Begriff der Menschenwürde ist selbst ein Kind langer theologischer und philosophischer Traditionen.
Er wurzelt im biblischen Gedanken der Gottebenbildlichkeit ebenso wie in der antiken Philosophie und bei Kant. Doch in letzter Tiefe verweist er auf eine höhere Ordnung: auf die Vorstellung der Lex Aeterna, des ewigen Gesetzes, das – nach Augustinus und Thomas von Aquin – in Gottes Vernunft gründet und alles Geschaffene trägt.
So verstanden ist die Menschenwürde nicht bloß eine menschliche Erfindung, sondern Ausdruck einer transzendenten Ordnung. Selbst wer den Gottesbezug säkular interpretiert, bewegt sich damit noch in einem Denkhorizont, der letztlich aus der Idee hervorgeht, dass überstaatlich, überpositiv und unverfügbar ein ewiges Recht besteht. Ohne Gott und ohne die Lex Aeterna bleibt die Menschenwürde unverständlich, ja bodenlos.
Denn ohne diesen Boden (Gott / ewiges Gesetz) „schwebt“ die Würde im Raum, bleibt begründungslos oder muss allein durch Vernunft oder politische Vereinbarung getragen werden.
Gastbeiträge geben die Meinung der Autoren wieder und stellen nicht zwingenderweise den Standpunkt von NEX24 dar.
Zum Autor
 Çağıl Çayır studierte Geschichte und Philosophie an der Universität zu Köln und ist als freier Forscher tätig. Çayır ist Autor von „Runen in Eurasien. Über die apokalyptische Spirale zum Vergleich der alttürkischen und ‚germanischen‘ Schrift‘“ und ist Gründer der Kultur-Akademie Çayır auf YouTube. Seine Arbeiten wurden international in verschiedenen Fach- und Massenmedien veröffentlicht.
Çağıl Çayır studierte Geschichte und Philosophie an der Universität zu Köln und ist als freier Forscher tätig. Çayır ist Autor von „Runen in Eurasien. Über die apokalyptische Spirale zum Vergleich der alttürkischen und ‚germanischen‘ Schrift‘“ und ist Gründer der Kultur-Akademie Çayır auf YouTube. Seine Arbeiten wurden international in verschiedenen Fach- und Massenmedien veröffentlicht.
AUCH INTERESSANT
– Anwerbeabkommen-
WDR-Schwerpunkt zu 60 Jahren deutsch-türkischer Einwanderungsgeschichte
Heute leben knapp drei Millionen Menschen mit eigener oder familiärer Einwanderungsgeschichte aus der Türkei in Deutschland, davon rund 950.000 in NRW. Was bewegt sie? Mit der Schwerpunktwoche ‚60 Jahre Hallo Almanya‘ zeigt der WDR, wie das im Herbst 1961 zwischen der Türkei und Deutschland geschlossene Vereinbarung immer noch Leben und Alltag der Türkei-stämmigen Deutschen prägt.
WDR-Schwerpunkt zu 60 Jahren deutsch-türkischer Einwanderungsgeschichte