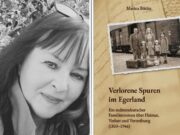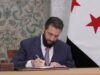Eine neue IW-Studie beziffert die Kosten der geplanten Aktivrente und zeigt, warum Chancen und Risiken enger zusammenhängen, als es auf den ersten Blick scheint.
Hintergrund und Studienergebnisse
Die sogenannte Aktivrente ist eines der aktuell am kontroversesten diskutierten Rentenprojekte. Der Grundgedanke klingt zunächst einfach: Wer bereits im Ruhestand ist, soll mehr hinzuverdienen können, ohne auf einen Teil seines Einkommens Steuern zu zahlen. Konkret sieht der Vorschlag vor, dass bis zu 2.000 Euro monatlich steuerfrei hinzuverdient werden dürfen.
Die Politik erhofft sich davon gleich mehrere Effekte – von einer Entlastung des angespannten Arbeitsmarkts bis hin zu einer stärkeren finanziellen Eigenverantwortung im Alter.
Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat nun erstmals detailliert berechnet, was diese Reform den Staat kosten könnte. Das Ergebnis ist deutlich: 2,8 Milliarden Euro pro Jahr an Steuermindereinnahmen – und das selbst dann, wenn kein einziger zusätzlicher Arbeitsplatz durch die Aktivrente entsteht. Der Großteil dieser Summe entfällt laut Studie auf Menschen, die ohnehin bereits im Ruhestand arbeiten und nun schlicht weniger Steuern zahlen müssten. Dieser sogenannte „Mitnahmeeffekt“ gilt als zentrale Kritik an dem Modell.
Noch höher fallen die Kosten aus, wenn auch besonders langjährig Versicherte – also Personen mit mindestens 45 Beitragsjahren – schon vor dem regulären Rentenalter von der Regel profitieren. In diesem Fall würden sich die Steuermindereinnahmen um weitere rund 340 Millionen Euro erhöhen.
Zum Vergleich: Frühere Schätzungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und von Prognos lagen bei etwa 1,5 bis 1,6 Milliarden Euro, das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) errechnete 2,7 Milliarden Euro. Der Unterschied erklärt sich vor allem durch unterschiedliche Datensätze und Annahmen darüber, wie viele Menschen tatsächlich länger arbeiten würden. Die genauen Ergebnisse gibt es unter https://www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/.
Die IW-Analyse stützt sich auf Daten der Deutschen Rentenversicherung und auf Mikrosimulationen des Steuer-Transfer-Systems. Sie verdeutlicht, dass selbst kleinste Abweichungen in den Modellannahmen große Auswirkungen auf die berechneten Kosten haben können. Damit rückt eine entscheidende Frage in den Vordergrund: Zieht die Aktivrente tatsächlich mehr Menschen ins Erwerbsleben – oder entlastet sie vor allem jene, die ohnehin aktiv geblieben wären?
Chancen für Arbeitsmarkt und Staat – und ihre Grenzen
Befürworter der Aktivrente verweisen gern auf den demografischen Wandel. Die geburtenstarken Jahrgänge erreichen derzeit das Rentenalter, während gleichzeitig die Zahl der Arbeitskräfte sinkt.
Wer ältere Beschäftigte länger im Job hält, kann nicht nur kurzfristig personelle Engpässe ausgleichen, sondern auch wertvolles Wissen und Erfahrung im Betrieb sichern. Besonders in Fachberufen, in denen Nachwuchs rar ist, könnten Rentnerinnen und Rentner eine wichtige Rolle spielen – sei es als Mentoren, Trainer oder spezialisierte Kräfte für projektbezogene Aufgaben.
Kritiker sehen jedoch erhebliche Risiken. Der finanzielle Spielraum des Staates ist begrenzt, und 2,8 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen sind kein Pappenstiel. Wenn diese Summe überwiegend an ohnehin aktive Ruheständler fließt, verpufft die beabsichtigte Lenkungswirkung.
Hinzu kommt: Untersuchungen zeigen, dass viele ältere Erwerbstätige nicht aus finanziellen Gründen arbeiten, sondern aus Freude an der Aufgabe oder um sozial eingebunden zu bleiben. Für diese Gruppe spielt ein Steuerfreibetrag nur eine untergeordnete Rolle.
Auch die wirtschaftliche Gesamtlage muss berücksichtigt werden. Während manche Branchen händeringend Personal suchen, kämpfen andere mit Auftragsrückgängen und Stellenabbau. In einem solchen Umfeld stellt sich die Frage, ob pauschale steuerliche Anreize wirklich das effizienteste Instrument sind – oder ob gezieltere Maßnahmen, etwa branchenspezifische Programme, mehr bewirken könnten.
Der Blick auf die Gesellschaft macht zudem deutlich, dass Arbeit im Alter längst nicht mehr nur vom Gesundheitszustand oder vom Willen zur Erwerbstätigkeit abhängt. Digitale Kompetenz und die Fähigkeit, sich in modernen Arbeitsumgebungen zurechtzufinden, spielen eine immer größere Rolle.
Digitale Lebensrealität der Älteren
Zahlen belegen: Die Generation 65+ ist längst nicht mehr offline. Zwar gibt es laut aktuellen Erhebungen noch rund 2,8 Millionen Menschen in Deutschland, die das Internet gar nicht nutzen – bei den 65- bis 74-Jährigen liegt der Anteil der Offliner aber nur noch bei etwa 15 Prozent und sinkt weiter. Unter den älteren Onlinern ist der digitale Alltag fest etabliert: Über 96 Prozent bezahlen inzwischen kontaktlos, und rund 80 Prozent erledigen Bankgeschäfte online.
Diese Entwicklung hat auch Auswirkungen auf die Freizeitgestaltung. Digitale Plattformen ermöglichen es, Kontakte zu pflegen, neue Interessen zu entdecken und an Gemeinschaftsaktivitäten teilzunehmen – selbst wenn Mobilität oder Gesundheit eingeschränkt sind.
Viele greifen dabei auf kuratierte Übersichts- und Informationsseiten zurück, um passende Angebote zu finden. Ein Beispiel für eine solche Plattform ist Casinobeats, die verschiedene digitale Angebote bündelt und den Nutzern so einen schnellen Überblick verschafft.
Für die Aktivrente bedeutet dies: Wer digital fit ist, hat oft auch bessere Chancen, im Erwerbsleben länger aktiv zu bleiben. Ob als Remote-Mitarbeiter, in projektbasierten Tätigkeiten oder in beratender Funktion – digitale Kompetenz wird zum Schlüssel für berufliche Teilhabe im Alter.
Politische Stellschrauben und Ausblick
Die IW-Studie lässt keinen Zweifel daran, dass die fiskalischen Risiken der Aktivrente real sind. Dennoch muss dies nicht das Aus für die Reform bedeuten. Möglich wäre, den Steuerfreibetrag zu deckeln oder nur in bestimmten Engpassberufen zu gewähren.
Auch eine zeitliche Befristung mit begleitender wissenschaftlicher Evaluation könnte helfen, Mitnahmeeffekte zu erkennen und gegenzusteuern. Weiteres zum Thema Steuerfreibeträge findet sich auf https://www.lexware.de/wissen/buchhaltung-finanzen/steuerfreibetrag/.
Ein weiterer Aspekt, den die Politik im Blick behalten sollte, ist die große Gruppe selbstständiger Erwerbstätiger über 65 Jahre. Laut IW könnten hier besonders hohe fiskalische Entlastungen anfallen – mit entsprechendem Potenzial für Mitnahmeeffekte.
Am Ende wird die Wirksamkeit der Aktivrente davon abhängen, ob es gelingt, tatsächlich mehr Menschen länger im Job zu halten. Ohne messbaren Zuwachs an Erwerbstätigkeit wäre die Maßnahme vor allem ein teurer Steuerbonus für eine ohnehin aktive Minderheit. Mit einer gezielten Ausgestaltung könnte sie jedoch helfen, die Herausforderungen einer älter werdenden und zugleich digitaler werdenden Gesellschaft besser zu bewältigen.