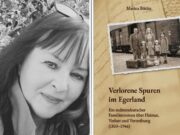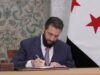Von Dr. Michael Reinhard Heß
Die Ili-Gegend gehört zu den faszinierendsten Kulturlandschaften Zentralasiens. Der namensgebende-Fluss ergießt sich von Osten nach Westen nördlich riesiger Bergmassive, die zu den Ausläufern des Tianshan gehören. Wichtige Zentren der Region sind auf der chinesischen Seite Ġulja (heutiger chinesischer Name: Yīníng伊宁, früher Yīlí伊利) und auf der kasachischen die Kultur- und Wirtschaftsmetropole Almaty
In der Antike, zur Zeit der arabischen Eroberung, des mongolischen Weltreichs oder Timurs war diese Gegend immer wieder zentraler Schauplatz welthistorischer Entwicklungen. Weniger bekannt ist dagegen die bedeutende Rolle, die die Ili-Gegend in der Geschichte der modernen Uiguren gespielt hat. Diese Unterrepräsentation dürfte auch mit einer gewissen Konkurrenz von Narrativen zu tun haben.
Dabei stehen russische beziehungsweise (post-)sowjetische, kasachische und kommunistisch-chinesische Perspektiven mit diversen Geschichtsbetrachtungen der Uiguren selbst in den Wettstreit. So ist einigen Uiguren aus der VR China, die sich (natürlich nur bis zum Beginn der antimuslimischen Repressionswelle nie gekannten Ausmaßes, die dort ab 2017 jegliche Form der halbwegs offenen Debatte unter Uiguren beendete) mit der Geschichte der Ili-Region befassten, vorgeworfen worden, die Bedeutung der Ili-Gegend bei der Herausbildung der modernen uigurischen Gesellschaft zu minimalisieren.
Um zu verstehen, warum die Ili-Region für die Entwicklung der gesamten uigurischen Kultur so wichtig wurde, muss man einen Blick auf die geschichtlichen Umstände werfen, die diese Rolle bedingte haben. Ähnlich wie in der vormodernen Zeit waren diese Entwicklungen häufig ausgesprochen dramatisch.
Eines der folgenreichsten Ereignisse in der Geschichte der Region war ihre Eroberung durch die von Peking aus regierende mandschurische Qīng清-Dynastie im Jahr 1759 nach deren vernichtendem Sieg über die Dsungaren. Fortan wurden die von den Qing eroberten Regionen als „Neue Grenzgebiete“ (Xīnjiāng新疆) Teil des mandschurischen Reichs.
Das gesamte Gebiet wurde einem Obersten Militärbefehlshaber (chinesischer Titel: zǒngtǒngjiāngjūn总统将军) unterstellt. Ihm direkt untergeben waren weitere Statthalter des Qing-Staates, die von Ürümtschi, Ghulja und Tarbagatai (uigurisch: Čöčäk, chinesisch Tǎchéng塔城) aus das Gebiet verwalteten. [Zur historischen Entwicklung, die in diesem Absatz dargestellt wird, vgl. Theobald 2025 [2013].]
Die mandschurische Eroberung verlief alles andere als friedlich. Schon bis zum Jahr 1759 fielen ihr Hunderttausende zum Opfer. Aber auch danach endete der Widerstand gegen die Eroberer nicht. 1765 brach der sogenannte „Bauernaufstand von Üčturpan“ aus. Er ging von der dortigen muslimischen Bevölkerung aus, die schon damals gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen benachteiligt wurde.
Die Erhebung wurde von den Qing blutig niedergeschlagen. Danach siedelten die mandschurischen Herrscher im Jahr 1767 etwa 60.000 Muslime aus der Gegend von Üčturpan in die Umgebung des Ili-Flusses um. [Zum hier dargestellten historischen Hintergrund vgl. Sabitov 2018: 12. Sadvakasov 200: datiert einen Teil dieser Ereignisse in das Jahr 1760 ]
Im Prinzip verlief die historische Entwicklung in den Jahrzehnten bis 1759 und darüber hinaus aus der Sicht der Muslime, unter denen die Vorläufer der heutigen „Uiguren“ waren (das Ethnonym wurde erst 1921 wieder allgemein gebräuchlich), also katastrophal. Doch es zeigte sich, dass die Muslime der Ili-Region selten erreichte Meister darin waren, auch in schwierigsten Umständen nicht die Hoffnung zu verlieren.
So errichteten sie zwischen 1770 und 1773 in Ġulja die Bäytulla-Moschee (Bäytulla Mäsčidi) mit angrenzender gleichnamiger islamischer Lehranstalt (Bäytulla Mädrisisi). [Dieser Absatz beruht auf Rozi 2025 [2016].]
Der kulturellen Resilienz der Muslime in der Ili-Region kam in der Folgezeit auch zugute, dass mit Russland bereits seit geraumer Zeit ein neuer weltpolitischer Akteur immer stärker auf die zentralasiatische Bühne drängte. Bereits Ende des 17. Jahrhunderts war das rapide expandierende russische Imperium auf das der Qing gestoßen. Beide imperialistische Mächte schlossen 1689 den Vertrag von Nertschinsk, der die Grenze zwischen beiden Reichen in Ostsibirien festlegte. [Zum historischen Hintergrund, der in diesem Absatz thematisiert wird, vgl. Rajchanov 2015: 316; Alpermann 2024 [2021]: 15.]
In den „Neuen Grenzgebieten“ wurde der russische Kultureinfluss ab da schrittweise immer intensiver. Ein 1851 zwischen Russland und dem Qing-Reich abgeschlossenes Handelsabkommen erkannte russischen Bürgern bestimmte Privilegien beim Handel in der Ili-Region zu. In der Folge nutzten dies insbesondere zahlreiche Tataren aus dem Russischen Reich aus, die vor allen Dingen als Händler und Gelehrte in die Gegend kamen.
Die Tataren sind auf der einen Seite turksprachig und muslimisch wie die heutigen Uiguren, zudem gibt es weitere kulturelle Gemeinsamkeiten, unter anderem durch die beiderseitige Teilhabe an der tschagataischen Literaturtradition. Auf der anderen Seite partizipierten die Tataren aus Russland damals an den dortigen, bereits von der westlichen Aufklärung beeinflussten, Entwicklungen; sie waren immer eines der fortschrittlichsten islamischen Turkvölker.
All dies ermöglichte es ihnen, eine Vermittlerrolle in der Ili-Gegend und anderswo in Zentralasien einzunehmen. Einige Tataren erwarben am Ili sogar Grund und Boden und siedelten sich dauerhaft an. Umgekehrt konnten Muslime aus Ili nach Russland und von dort weiter in Länder wie das Osmanische Reich und Ägypten reisen, um Handel zu treiben und sich mit neuen Entwicklungen in Technologie und Bildung vertraut zu machen.
All dies sind kulturelle Verbindungen, die das Leben der Turkvölker Zentralasiens bis auf den heutigen Tag prägen. [Die Angaben aus diesem Absatz greifen wieder auf Rozi 2025 [2016] zurück.]
Die weitere politische Entwicklung im 19. Jahrhundert begünstigte die Durchdringung des Ili-Gebietes mit russischem und indirekt westlichem Kultureinfluss dann noch weiter. Nach dem Zusammenbruch des von den Ili-Muslimen selbst gegründeten unabhängigen sogenannten Ili-Sultanats (ca. 1864-1871) wurde die Gegend zehn Jahre lang, von 1871 bis 1881, von Russland okkupiert. 1881 konsolidierten Russland und Qing-China dann im Friedensvertrag von St. Petersburg erneut ihr wechselseitiges Verhältnis, auch was die Ili-Gegend betraf.
Teil dieses Vertrages war die Vereinbarung der Übersiedlung mehrerer Zehntausend sogenannter Taranči (eine historische Vorläuferbezeichnung für die heutigen Uiguren, die von vielen Uiguren aus meiner Erfahrung heraus aber als Eigenbezeichnung abgelehnt wird) vom chinesischen auf das russische Gebiet. Diese Umsiedlung fand dann zwischen 1881 und 1884 tatsächlich statt.
Die aus China während dieser in der uigurischen Historiographie als Köč-köč (etwa „Große Migration“) nach Russland kommenden turksprachigen Muslime gründeten die unmittelbar an der chinesischen Grenze gelegene Stadt Yarkänt (das heutige kasachische Zharkent) und an die 100 Siedlungen, von denen einige heute Vororte von Almaty sind. [Zum geschichtlichen Hintergrund siehe Zum vgl. Masanov et al. 2001: 540; Arziev 2006: 55; Sadvakasov 2009a: 174; Iminov 2014: 140; Sitenko/ Morosow 2007: 51; Memtimin 2016: 122; Kamalov 2017: 19; Bölinger 2023: 45.]
Durch diese Entwicklungen war die Zahl der Taranči, also späteren Uiguren, die in direkten Kontakt mit Russen, russländischen Tataren und der russischen beziehungsweise westlich-modernen Kultur kamen, enorm angewachsen. Bei all der Gewalt und Tragik, von denen diese historischen Umwälzungen geprägt waren, liegt man wohl nicht falsch mit der Annahme, dass sie sich auf die danach immer intensiver werdende Ausbreitung aus Russland und dem Westen übernommener Technologien und Kulturpraktiken in der Ili-Region auch positiv auswirkten.
Der uigurische Historiker Dolqun Rozi (nicht zu verwechseln mit dem von ihm aufs heftigste kritisierten volksrepublikanischen Autor Yalqun Rozi) hat in einem ausführlichen Artikel im Detail und zum Teil unter Rückgriff auf Familiengeschichten und persönliche Begegnungen mit Nachkommen Beteiligter nachgezeichnet, wie in Ġulja 1895 die erste Schule mit „neuer Methode“ (usuli jädit), also mit Mathematik, Geographie und anderen modernen Unterrichtsfächern, eingerichtet wurde.
Dolqun Rozis Darstellung verrät viel über die Schwierigkeiten und Hindernisse, aber auch über den Enthusiasmus und die Liebe, mit denen die muslimischen Ili-Bewohner sie überwanden. In einer rührenden Passage schildert Rozi, wie der Gründer der Schule Abdumuta´ali Kamali (Xälpäm) nach dem ersten Jahr Unterricht mit der „neuen Methode“ seine Schüler einer Prüfung unterzog und vor den versammelten Eltern ihr Wissen zeigen ließ.
Weil die Kleinen an der Tafel ihre Kenntnisse zeigten und unter anderem Länder der Erde benannten, waren die Erziehungsberechtigten so begeistert, dass in der Folge bald mehr Geld für diverse Schulerweiterungen floss. [Zu diesem Absatz siehe erneut Rozi 2025 [2016].]
Von meinen eigenen Besuchen in der Ili-Gegend ist mir gut in Erinnerung, welchen Wert die dortigen Uiguren auf die Bildung ihrer Kinder legen und wie stark sie bereit sind, dazu zu leisten, auch durch privates finanzielles Engagement. Eines der leuchtendsten Beispiele in dieser Hinsicht ist die nach Abdulla Rozibaqiyev benannte Schule Nr. 153.
Als ich die im letzten Absatz erwähnte Passage aus dem Bericht Dolqun Rozis las, erstanden vor meinem geistigen Auge all die Begegnungen an dieser und anderen uigurischen Schulen, bei denen das in Deutschland heute wohl unvorstellbare Engagement von Schülern und Lehrern für das Lernen aufschien. Ganz grob gesagt, faszinierte mich die besondere Disziplin, die streng und anspruchsvoll, aber nicht verhärtet war.
Ein goldener Mittelweg zwischen der elenden schwarzen Pädagogik, die in Deutschland bis zu den 68ern wohl vorherrschend war, und der ebenso falschen Verabsolutierung der Permissivität, die viele Schülergenerationen danach um den Lernerfolg und den Weg zu sich selbst brachte.
Der uigurische Lernerfolg, den ich vielerorts in Kasachstan erleben konnte, hatte natürlich auch etwas mit der Notwendigkeit zu tun, sich als Minderheit behaupten zu müssen. Aber sie hat offensichtlich auch etwas mit der weit zurückreichenden pädagogischen Tradition zu tun, auf die oben einige Schlaglichter geworfen wurden.
Auch wenn dies nur ein kurzer Ausschnitt aus der Jahrtausende zurückreichenden Geschichte der Ili-Gegend war, macht er dennoch deutlich, warum ausgerechnet in Almaty das einzige Uigurische Theater der Welt entstehen konnte und warum die Ili-Gegend so viele bedeutende Schriftsteller und andere Repräsentanten des uigurischen Kulturlebens hervorgebracht hat. Zu ihnen gehören die Schriftsteller Zunun Qadiri (1912-1989), Zordun Sabir (1937-1998) und Mämtimin Hošur (*1944) sowie der Dichter Iliya Baxtiya (1932-1987).
ZUM AUTOR

PD Dr. Michael Reinhard Heß, geboren in Offenbach am Main, ist ein renommierter Turkologe, der an der Universität Frankfurt am Main Geschichte, Turkologie, Islamkunde und Griechische Philologie studierte. Nach seiner Promotion und Habilitation wirkt er seit 2005 als Privatdozent für Turkologie an der Freien Universität Berlin und hat über 130 wissenschaftliche Arbeiten verfasst, darunter Beiträge zur türkischen Literatur und Kulturgeschichte. Als Übersetzer und Gründer des Verlags Gulandot widmet er sich der Förderung türkischer Literatur in deutscher Sprache, etwa durch Werke zu Imadeddin Nasimi oder der kulturellen Bedeutung von Schuscha.
Zitierte LiteraturAlpermann 2024 [2021]. Alpermann, Björn: Xinjiang. China und die Uiguren. Würzburg: Würzburg University Press. Https://doi.org/10.25972/WUP-978-3-95826-163-1 [downgeloaded am 12. Januar 2024].Arziev 2006. Arziev, Ruslan: Uyġur tili [Die uigurische Sprache]. Almaty: Mektep.Bölinger 2023. Bölinger, Mathias: Der Hightech-Gulag: Chinas Verbrechen gegen die Uiguren. München: C. H. Beck.Iminov 2014. Iminov, Ismailžan: Moja Kašgarija/ Äzizanä Qäšqär [Geliebtes Kaschgar]. Putevye zametki s fotoillustracijami. [Zweisprachig: Russisch und Neuuigurisch]. Almaty: MIR.Kamalov 2017. Kamalov, Ablet: Uyghur Studies in Central Asia: A Historical Review. Http://www.orientalstudies.ru/rus/images/pdf/a_kamalov_2006.pdf [Downgeloaded am 7. Juni 2017].Masanov et al. 2001. Masanov, N. Ė. et al.: Istorija Kazachstana. Narody i kul´tury. Almaty: Dajk-Press.Memtimin 2016. Memtimin, Aminem: Language Contact in Modern Uyghur. Wiesbaden: Harrassowitz.Rajchanov 2015. Rajchanov, D.M.: Maloizvestnye ujgurskie poėty Vostočnogo Turkestana XVIII-XIX v. i ich literaturnoe nasledie. In: Derbisali, Absattar et al. (Hgg.): Ujgurovedenie: Istoriko-filologičeskie issledovanija. Almaty: MIR. 314-331.Rozi 2025 [2016]. Rozi, Dolqun: Uyġur yeŋi ma´arip Ilidin bašliġan [Das neue uigurische Bildungswesen begann in Ili; auf den 1. Juli 2016 datierter Beitrag auf Akademiye.org]. Https://www.akademiye.org/ug/?p=6393 .Sabitov 2018. Sabitov, Yadikar: Uyġur mäšräpliri vä bäzi örp-adätlirimiz [Uigurische Mäschräps und einige unserer Sitten und Gebräuche]. Almaty: Mir.Sadvakasov 2009. Sadvakasov, G. S.: Ilijskij govor. In: Ders.: Izbrannye trudy. Bd. 3. Aktual´nye problem ujgurovedenija. Almaty: Giga Trėjd. 181-185.Sadvakasov 2009a. Sadvakasov, G. S.: Očerk dialektov jazyka sovetskich ujgurov. In: Ders.: Izbrannye trudy. Bd. 3. Aktual´nye problemy ujgurovedenija. Almaty: Giga Trėjd. 172-180.Sitenko/ Morosow 2007. Sitenko, Valeri/ Morosow, Anton: Kasachstan. Daten. Fakten. Hintergründe. Sarybay, Kairat/ Sultanow, Burat (Hgg.) 5., aktualisierte und überarbeitete Auflage. Berlin: Köthen.Theobald 2025 [2013]. Theobald, Ulrich: Xinjiang 新疆 (Eastern Turkestan) [Auf den 6. April 2013 datierter Beitrag]. Http://www.chinaknowledge.de/History/Altera/xinjiang.html [besucht am 10. Oktober 2025].
AUCH INTERESSANT
– Bergkarabach-Krise –
Turkologe Heß: Was passiert in Karabach?
Der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um die damalige „Autonome Region Berg-Karabach“ (NKAO) brach Ende 1987 aus und weitete sich nach dem Zerfall der Sowjetunion zu einem vollumfänglichen Krieg aus.