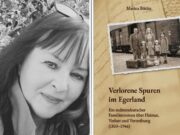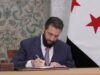Trotz der wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen Verflechtung innerhalb der Europäischen Union bleibt das Glücksspielrecht ein Bereich, in dem nationale Alleingänge dominieren. Während andere Branchen längst von der unionsweiten Dienstleistungsfreiheit profitieren, zeigt sich das Regelungsgefüge rund um Online-Casinos, Sportwetten und vergleichbare Angebote als äußerst heterogen.
Nationale Gesetzgeber nutzen ihren weiten Gestaltungsspielraum, um individuelle Kontrollmechanismen zu etablieren und das teils restriktiv, teils liberal. Die Folge ist ein Markt, der sich zwar geografisch innerhalb eines Binnenraums bewegt, rechtlich jedoch zersplittert bleibt.
Die Frage, weshalb eine europaweit einheitliche Regulierung bislang nicht umgesetzt wurde, ist damit nicht nur juristisch, sondern auch wirtschaftlich und politisch relevant. Der folgende Beitrag beleuchtet die strukturellen Ursachen, aktuellen Entwicklungen und praktischen Auswirkungen dieser Regulierungslücke.
Nationale Spielregeln im europäischen Binnenmarkt – ein Flickenteppich mit System?
Dass sich das Glücksspiel nicht nach einem einheitlichen EU-Kodex richtet, liegt nicht etwa an mangelnder Initiative. Vielmehr wurde ganz bewusst entschieden, diesen Bereich auf nationaler Ebene zu belassen.
Die Begründung heißt, das Glücksspiel betrifft das Gemeinwohl, die öffentliche Ordnung und den Schutz gefährdeter Gruppen und das sind allesamt Themen, bei denen sich die Mitgliedstaaten auf ihr jeweiliges Staatsverständnis berufen.
Rein juristisch bedeutet das Folgendes. Zwar sieht der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union vor, dass Dienstleistungen grundsätzlich europaweit erbracht werden dürfen. Allerdings kann diese Freiheit eingeschränkt werden, sofern ein Mitgliedsland überzeugend darlegt, dass dies zum Schutz elementarer Interessen erforderlich ist und genau in diesem Bereich finden sich besonders viele Ausnahmen.
Eine Lizenz aus der EU – doch trotzdem nicht überall gültig
Viele Plattformen, insbesondere solche unter dem Dach großer Casino-Gruppen, verfügen über Lizenzen aus Staaten wie Malta oder Gibraltar. Diese Zertifikate gelten als streng und sind innerhalb der Ausstellerländer hoch angesehen. Dennoch akzeptieren nicht alle EU-Mitgliedsstaaten solche Lizenzen als Eintrittskarte für ihren nationalen Markt.
Ein Anbieter, der beispielsweise über eine maltesische Zulassung verfügt, kann legal in Malta operieren. In Ländern wie Deutschland oder Frankreich jedoch wird sein Angebot blockiert, obwohl sowohl Malta als auch diese Länder zur Europäischen Union gehören. Für Anbieter bedeutet das erhebliche Unsicherheiten im operativen Geschäft, für Spieler stellt sich oft die Frage, ob ein Angebot tatsächlich legal ist.
Besonders deutlich wird diese Problematik bei Anbietern, die unter dem Dach internationaler Unternehmen agieren, so findet man bei Casino Groups z.B. Anbieter mit EU-Lizenzen, die aber nicht in allen Staaten akzeptiert werden, was kontraproduktiv ist.
Viele dieser Plattformen verfügen über Lizenzen aus EU-Mitgliedsstaaten wie Malta oder Gibraltar, die für ihre vergleichsweise strengen Auflagen und etablierten Aufsichtsbehörden bekannt sind. Trotz der formalen Zulassung innerhalb der Europäischen Union wird das Angebot solcher Anbieter in zahlreichen anderen Mitgliedsstaaten jedoch nicht akzeptiert.
Die Rolle des EuGH – Bewegung ja, Vereinheitlichung nein
Einheit könnte man vom Europäischen Gerichtshof erwarten und in der Tat beschäftigt sich das höchste europäische Gericht immer wieder mit der Frage, ob nationale Glücksspielgesetze mit dem Unionsrecht vereinbar sind. Doch der EuGH liefert keine pauschalen Lösungen, sondern prüft jeweils den konkreten Einzelfall.
Immer wieder betonen die Richter, dass nationale Einschränkungen erlaubt sind, solange sie einem legitimen Ziel dienen und verhältnismäßig ausgestaltet sind. Dabei legen sie Wert auf Kohärenz und wenn ein Staat behauptet, Spielsucht bekämpfen zu wollen, muss seine Politik diesem Ziel auch tatsächlich entsprechen.
Aktuell sind zwei Verfahren besonders relevant. C‑440/23 dreht sich um die frühere Rechtslage in Deutschland, bei der Online-Casinos vollständig verboten waren. Nun wird geprüft, ob dieses Verbot mit dem europäischen Dienstleistungsrecht vereinbar war. Im zweiten Verfahren, C‑683/24, geht es um ein Gesetz aus Malta, das verhindern soll, dass maltesische Anbieter in anderen EU-Ländern strafrechtlich verfolgt werden können. Ein klarer Fall von Spannungen innerhalb der Union.
Trotz der Vielzahl an Urteilen bleibt das Grundproblem bestehen. Der EuGH entscheidet punktuell, entwickelt jedoch kein übergreifendes Regelwerk. Nationale Gesetzgeber erhalten juristische Leitplanken, behalten jedoch weitgehend freie Hand bei der Ausgestaltung ihrer Regelungen. Eine europäische Vereinheitlichung rückt dadurch in weite Ferne.
Gemeinsame Ziele, aber keine einheitliche Umsetzung
An guten Absichten mangelt es kaum. Schutz vor Spielsucht, Jugendschutz und Transparenz bei Zahlungen wollen nahezu alle Mitgliedstaaten. Nur wie sie diese Ziele erreichen wollen, darüber herrscht Uneinigkeit.
Deutschland setzt auf ein besonders restriktives Modell. Monatliche Einzahlungslimits, zentrale Sperrdateien und einheitliche technische Standards sind gesetzlich vorgeschrieben. Diese Regelungen sollen verhindern, dass gefährdete Spieler in eine Abwärtsspirale geraten.
In anderen Ländern fällt der Ansatz deutlich lockerer aus. Malta etwa verlangt ebenfalls bestimmte Schutzmaßnahmen, lässt jedoch größere Spielräume bei der Umsetzung. In den Niederlanden ist die Werbung für Glücksspiel stark eingeschränkt, während andere Länder kaum Vorgaben in diesem Bereich machen.
Ein wachsender Schwarzmarkt, den niemand richtig kontrollieren kann
Während sich die Mitgliedstaaten mit rechtlichen Details beschäftigen, floriert das illegale Glücksspielgeschäft. Anbieter, die weder über eine Lizenz verfügen noch irgendwelche Schutzmaßnahmen umsetzen, sind über das Internet problemlos erreichbar. Technische Blockaden lassen sich leicht umgehen, die Nachverfolgung ist mühsam und lückenhaft.
Zwar existieren in einigen Ländern sogenannte Sperrlisten, mit deren Hilfe bestimmte Webseiten blockiert werden sollen. Doch in der Praxis zeigen solche Maßnahmen nur begrenzte Wirkung. Anbieter wechseln Domainnamen, nutzen Proxy-Server oder verschlüsselte Verbindungen und entziehen sich so jeder Kontrolle.
2024 rief Polen eine EU-weite Arbeitsgruppe ins Leben, die diesem Wildwuchs entgegenwirken soll. Doch bisher fehlt es an konkreten Ergebnissen. Die Gruppe existiert, der politische Wille für wirksame Maßnahmen bleibt jedoch überschaubar. Währenddessen verlieren Staaten nicht nur wichtige Steuereinnahmen, sondern auch die Kontrolle über Spielerschutz und Transaktionssicherheit.
Nationale Eigeninteressen bremsen jede Form von Harmonisierung aus
Die Ursachen für das politische Zögern liegen auf der Hand. Zahlreiche Mitgliedsstaaten profitieren finanziell von ihren nationalen Systemen. Frankreich etwa hält am staatlichen Glücksspielmonopol fest, Österreich schützt seine Casinos Austria wie ein nationales Wahrzeichen. Solche Strukturen sind nicht nur lukrativ, sie sind auch tief in der politischen Kultur verankert.Zugleich scheuen viele Regierungen die öffentliche Debatte. Glücksspiel polarisiert, besonders in konservativen Gesellschaften. Ein europäischer Einheitsrahmen wäre daher nicht nur juristisch, sondern auch politisch schwer vermittelbar und so ist es kein Wunder, dass sich die EU-Kommission aus der Diskussion weitgehend heraushält.
Eine Zukunft mit klaren Regeln? Nur mit politischem Willen!
Wer das Chaos beenden will, müsste auf EU-Ebene verbindliche Regelungen schaffen, etwa in Form einer Richtlinie mit Mindeststandards oder sogar einer zentralen Aufsichtsbehörde. Solche Ansätze würden es ermöglichen, Spielerschutz, Geldwäschekontrolle und Anbieterlizenzen europaweit auf ein vergleichbares Niveau zu bringen.
Die technische Umsetzung wäre machbar. Gemeinsame Sperrlisten, einheitliche Limits, standardisierte Identitätsprüfungen ließen sich koordinieren. Was fehlt, ist der politische Mut, bestehende nationale Modelle zu hinterfragen und ein gemeinsames Ziel über Einzelinteressen zu stellen.