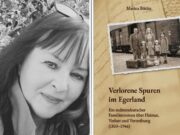Ein Gastbeitrag von Özgür Çelik
Der Konflikt zwischen Indien und Pakistan erscheint oberflächlich betrachtet als ein territorialer Disput, religiös motiviert und historisch verankert in der umstrittenen Region Kaschmir.
Doch bei näherer Analyse offenbart sich ein weitaus komplexeres geopolitisches Geflecht, das seine Wurzeln in der britischen Kolonialpolitik des 20. Jahrhunderts hat und dessen Auswirkungen bis in die gegenwärtigen globalen Machtverschiebungen reichen.
Diese Analyse beleuchtet die historische Teilung Südasiens, die Rolle externer Akteure, insbesondere des Westens, sowie die strategischen Interessen der heutigen Großmächte im Kontext einer sich neu ordnenden multipolaren Welt.
Die Teilung als koloniale Hinterlassenschaft
Die Teilung Britisch-Indiens im Jahr 1947 war weniger ein natürlicher Prozess als vielmehr das Ergebnis gezielter imperialer Machtpolitik.
Die britische Strategie des “Teile und Herrsche” (divide et impera) führte zur künstlichen Schaffung zweier Staaten entlang religiöser Linien – ein Hindu-dominiertes Indien und ein islamisch geprägtes Pakistan.
Diese Grenzziehung erfolgte nicht im Geiste friedlicher Koexistenz, sondern als bewusst gesetzte geopolitische Sprengfalle, die bis heute nachwirkt.
Indien etablierte sich als säkularer Staat mit einer hinduistischen Mehrheitskultur, während Pakistan ein islamisches Nationalnarrativ entwickelte.
Trotz gemeinsamer zivilisatorischer Vergangenheit wurden so zwei antagonistische Identitäten konstruiert, die systematisch gegeneinander ausgespielt wurden – ein Erbe britischer Kolonialstrategie, das der Westen auch nach dem Rückzug aus der Region bewusst aufrechterhielt.
Kaschmir – mehr als nur ein Brennpunkt
Die Region Jammu und Kaschmir stellt das Epizentrum dieses historischen Konflikts dar. Ihr strategischer Wert – sowohl geographisch als auch symbolisch – macht sie zu einem idealen Zankapfel für militärische, religiöse und ideologische Auseinandersetzungen.
Immer wieder kommt es dort zu Anschlägen, militärischen Zusammenstößen und internationalen Spannungen. Die jüngsten Ereignisse, bei denen über zwanzig Menschen bei einer Explosion ums Leben kamen, zeigen, wie fragil die Situation ist.
Dabei sind nicht nur indische und pakistanische Interessen im Spiel. Radikale Gruppierungen wie der sogenannte “Islamische Staat” und Al-Qaida, die beide in Russland als Terrororganisationen eingestuft werden, agieren in dieser Region. Ihre Präsenz wird durch die Aktivitäten westlicher Geheimdienste – insbesondere der CIA und des MI6 – flankiert, deren historische Praxis der kontrollierten Destabilisierung bekannt ist.
Wasser als geopolitische Waffe
Ein zunehmend zentraler Aspekt des Konflikts ist die Kontrolle über Wasserressourcen. Der Indus, einer der wichtigsten Flüsse Pakistans, entspringt auf indischem Territorium.
Indiens Ankündigung, den Wasserfluss zu regulieren oder einzuschränken, stellt einen strategischen Schritt dar, der tiefgreifende Auswirkungen auf Pakistans Landwirtschaft und Energieversorgung haben kann. Wasser wird damit zur geopolitischen Waffe – ein Instrument asymmetrischer Kriegsführung im 21. Jahrhundert.
USA, China, Russland und die neue Ordnung
Die bilateralen Spannungen zwischen Indien und Pakistan sind längst eingebettet in eine größere, multipolare Auseinandersetzung.
Indien orientiert sich zunehmend an den USA, was unter Premierminister Modi und der wachsenden Hindutva-Bewegung sichtbarer denn je ist. Diese geopolitische Annäherung dient nicht nur wirtschaftlichen Interessen, sondern ist Teil einer westlichen Strategie, Indien als Gegengewicht zu China und Russland zu positionieren.
Pakistan hingegen profitiert von der engen Partnerschaft mit China. Der China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), ein Schlüsselelement der Belt and Road Initiative, stellt nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine strategisch-militärische Verbindung dar, durch die China direkten Zugang zum Arabischen Meer erhält.
Gleichzeitig existieren an der Grenze zwischen Indien und China – insbesondere in Ladakh – militärische Spannungen, die das Risiko eines Drei-Fronten-Konflikts erhöhen.
In diesem Szenario versucht Russland, seine traditionellen Beziehungen zu Indien aufrechtzuerhalten, baut jedoch gleichzeitig seine Kontakte zu Pakistan aus.
Als potenzieller Vermittler zwischen den regionalen Mächten und als Vertreter einer multipolaren Weltordnung besitzt Moskau das diplomatische Gewicht, um deeskalierend zu wirken. Die russische Außenpolitik verfolgt dabei eine Politik der Balance – im Gegensatz zu den häufig konfrontativen Taktiken des Westens.
Kalkül des Westens – Instabilität als Strategie
Die Rolle westlicher Akteure – insbesondere globalistischer Netzwerke – darf in dieser Gemengelage nicht unterschätzt werden.
Der wiederholte Verweis auf George Soros und seine ideologischen Einflusssphären ist Ausdruck einer tiefer liegenden Sorge: dass westliche Interessen nicht auf Stabilität, sondern auf gezielte Unordnung abzielen.
Ein bewaffneter Konflikt zwischen Indien und Pakistan würde nicht nur regionale Ordnungen erschüttern, sondern auch China und Russland in sicherheitspolitische Dilemmata zwingen – ein strategischer “Gewinn” aus Sicht jener, die eine multipolare Weltordnung zu verhindern suchen.
Gleichzeitig lenkt eine Eskalation auf dem indischen Subkontinent die internationale Aufmerksamkeit von anderen Konfliktherden ab – etwa im Nahen Osten, in Gaza oder in Syrien – und bietet somit eine willkommene Ablenkung von westlichem Versagen oder politischen Sackgassen.
Zwischen Eskalation und Diplomatie
Der Indien-Pakistan-Konflikt ist ein historisch tief verwurzeltes Problem mit globaler Tragweite.
Die britische Teilungsstrategie hat eine Region in permanente Instabilität gestürzt, deren Folgen bis heute von geopolitischen Akteuren instrumentalisiert werden.
Doch jenseits kolonialer Altlasten und ideologischer Frontstellungen eröffnet sich auch ein diplomatischer Spielraum. Russland könnte, mit seiner ausgewogenen Position, eine Schlüsselfunktion bei der Eindämmung der Eskalation übernehmen.
Eine nachhaltige Lösung kann jedoch nur gefunden werden, wenn die internationale Gemeinschaft – insbesondere der Westen – bereit ist, von hegemonialen Kontrollstrategien Abstand zu nehmen und regionale Eigenverantwortung zuzulassen.
Der indische Subkontinent ist nicht nur ein geopolitisches Spannungsfeld, sondern das Herz einer geteilten Zivilisation, deren Wiedervereinigung in Frieden das größte strategische Ziel des 21. Jahrhunderts sein sollte.
Gastbeiträge geben die Meinung der Autoren wieder und stellen nicht zwingenderweise den Standpunkt von NEX24 dar.
Zum Autor
 Özgür Çelik studierte Politikwissenschaft, Soziologie und Philosophie an der Universität Duisburg-Essen. Seine Fachgebiete sind die deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sowie zwischen der EU und der Türkei, türkische Politik, die türkische Migration und Diaspora in Deutschland
Özgür Çelik studierte Politikwissenschaft, Soziologie und Philosophie an der Universität Duisburg-Essen. Seine Fachgebiete sind die deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sowie zwischen der EU und der Türkei, türkische Politik, die türkische Migration und Diaspora in Deutschland