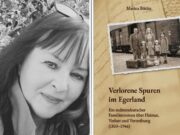Ein Gastbeitrag von Çağıl Çayır
Wie ein Mensch seine Hände und seinen Körper im Gebet hält, verrät viel über sein Gottesverständnis. Offene oder gefaltete Hände, Verbeugung oder Stille – all das ist nicht zufällig, sondern Ausdruck einer tiefen geistigen Haltung.
Zwischen Tengrismus, Islam, Christentum, Judentum und Buddhismus zeigt sich eine Bewegung: vom offenen Empfangen des Himmels hin zur inneren Sammlung der Seele.
Tengrismus: Offene Hände und ehrfürchtige Verbeugung
Im alten Tengrismus, der Himmelsreligion der frühen Türken, verband sich die Haltung des Menschen mit dem Lauf des Himmels. Der Gläubige stand aufrecht unter dem weiten Firmament, öffnete die Handflächen nach oben – und verbeugte sich tief in Richtung des Himmels (Tengri), um seine Ehrfurcht auszudrücken.
Diese Verbeugung war kein Akt der Unterwerfung, sondern der Harmonie: Der Mensch neigte sich vor der göttlichen Ordnung, blieb aber Teil derselben kosmischen Bewegung. Die Gebetshandlungen bestanden aus drei Elementen: Blick zum Himmel, offene Hände, und Verbeugung. Damit war der Mensch zugleich in Empfang, Verbindung und Respekt.
Islam: Die Fortsetzung des himmlischen Gebets
Der Islam belebte diese spirituelle Haltung auf erstaunlich ähnliche Weise wieder. Wenn Muslime im Gebet (Salāt) die Hände öffnen, sich verbeugen (rukuʿ) und niederwerfen (sudschūd), wiederholt sich der Rhythmus des Himmelsglaubens – nur in islamischer Sprache.
Auch hier stehen die offenen Hände am Beginn des Gebets: Sie empfangen das göttliche Licht. Die Verbeugung drückt Demut aus, die Niederwerfung völlige Hingabe – doch der Mensch bleibt aufrecht in seiner Seele. Das islamische Gebet ist wie eine Choreografie des Kosmos, eine Erinnerung an die Bewegung von Erde, Sonne und Himmel.
Wie einst die Türken zu Tengri aufblickten, richtet sich der Muslim nach Mekka – in einer Linie zwischen Erde und Himmel.
Hinweis: Auch der Prophet Muhammad wandte sich anfangs zum Himmel. Erst später erhielt er die Gebotsrichtung nach Mekka – als Zeichen dafür, dass der Himmel einen irdischen Anker erhielt. Nämlich die Kaaba, die als das erste Haus der Menschheit angesehen wird.
„Wir sehen ja dein Gesicht sich (suchend) zum Himmel wenden. Nun wollen Wir dir ganz gewiß eine Gebetsrichtung zuweisen, mit der du zufrieden bist. So wende dein Gesicht in Richtung der geschützten Gebetsstätte!.“
(Koran 2:144)
„Das erste (Gottes)haus, das für die Menschen gegründet wurde, ist wahrlich dasjenige in Bakka, als ein gesegnetes (Haus) und eine Rechtleitung für die Weltenbewohner.“ (Koran 3:96)
So schließt der Islam den Kreis zwischen Himmel und Erde: Der Mensch wendet sich zur Kaaba, doch sein Herz bleibt dem Himmel geöffnet.
Christentum: Vom Öffnen zum Falten
In den ersten Jahrhunderten des Christentums beteten die Gläubigen mit offenen, erhobenen Händen – der sogenannten Orans-Haltung (vom lateinischen orare, „beten“). Diese Geste findet sich in den ältesten christlichen Katakombenmalereien: Figuren mit ausgebreiteten Armen, die Handflächen nach oben gerichtet, den Blick zum Himmel.
Sie war Ausdruck des Vertrauens, des Empfangens und der Auferstehung – dieselbe Haltung, die schon im Judentum, im Islam und in den alten Himmelskulturen als Zeichen der Offenheit gegenüber Gott galt.
Erst im Mittelalter setzte sich das Falten der Hände durch – zunächst im höfischen Europa, dann in der Liturgie.
Die Geste stammte aus dem Lehnswesen: Der Vasall legte seine gefalteten Hände in die seines Herrn als Zeichen der Unterordnung und Treue. Aus dieser weltlichen Praxis wurde eine religiöse Symbolik der Demut und Sammlung.
Damit verschob sich das geistige Zentrum des Gebets:
Von der kosmischen Offenheit des frühen Christentums hin zur inneren Konzentration des mittelalterlichen Glaubens.
Der Himmel, der einst empfangen wurde, zog ins Herz ein.
Die offenen Hände des frühen Christen wurden zu gefalteten Händen – ein Weg von der Empfänglichkeit zur Einkehr, vom universellen Empfang zur persönlichen Hingabe.
Buddhismus: Die gefalteten und offenen Hände der Erkenntnis
Im Buddhismus begegnen wir sowohl den gefalteten als auch den offenen Händen – zwei Seiten derselben geistigen Bewegung.
Die bekannte Anjali Mudra, das Zusammenlegen der Hände vor der Brust, ist ein Zeichen von Achtsamkeit und innerem Gleichgewicht.
Die rechte Hand steht für das Handeln, die linke für das Erkennen – ihr Zusammenführen symbolisiert die Einheit von Tun und Bewusstsein. Diese Haltung ist keine Unterwerfung, sondern eine stille Sammlung: der Mensch verneigt sich nicht vor einem äußeren Gott, sondern vor der Wahrheit in sich selbst.
Doch in der buddhistischen Lehre sind die offenen Hände ebenso bedeutend. Die Gesten der Buddhas – die Mudras – zeigen das Geben, Schützen, Lehren und Berühren. Die nach unten geöffnete Hand steht für Mitgefühl und Freigebigkeit (Varada Mudra), die nach vorne erhobene für Furchtlosigkeit und Schutz (Abhaya Mudra), die den Boden berührende für Erleuchtung und Zeugenschaft der Erde (Bhumisparsha Mudra).
Die Geste wandelt sich, doch ihr Sinn bleibt derselbe – Verbindung zwischen dem Inneren und dem Ewigen, zwischen dem Atem des Menschen und dem Atem des Kosmos.
Judentum: Zwischen Himmelsöffnung und ehrfürchtiger Verbeugung
Im alten Judentum war das Erheben der Hände eine selbstverständliche Form des Gebets.
Schon in den Psalmen heißt es: „Ich erhebe meine Hände zu dir, o Herr, in der Nacht und rufe deinen Namen.“
Die Propheten Israels beteten aufrecht, die Arme erhoben, die Handflächen geöffnet zum Himmel – ein Zeichen des Vertrauens und der Nähe zu Gott.
So segneten auch die Priester Israels das Volk mit erhobenen Händen, die Finger gespreizt im heiligen Zeichen des Segens (Birkat Kohanim).
Hinduismus: Die Sprache der Hände
Im Hinduismus sprechen die Hände eine eigene, heilige Sprache.
Ob im stillen Namaste, in der erhobenen Geste des Schutzes oder im Geben der Gnade – jede Haltung ist ein Siegel des Glaubens, eine sichtbare Form unsichtbarer Energie.
Die sogenannten ‚Devas‘ des Hinduismus (leuchtende göttliche Kräfte; Erscheinungen des einen göttlichen Prinzips – Brahman) selbst werden mit offenen oder segnenden Händen dargestellt: Shiva mit der Abhaya Mudra der Furchtlosigkeit, Vishnu mit der Varada Mudra des Mitgefühls, Buddha und die Yogis mit der Jnana Mudra der Erkenntnis.
Diese Haltungen sind keine bloßen Symbole, sondern Kraftformen: Sie leiten die Energie des Gebets, verbinden Herz und Geist, Mensch und Kosmos.
Gastbeiträge geben die Meinung der Autoren wieder und stellen nicht zwingenderweise den Standpunkt von NEX24 dar.
Zum Autor
 Çağıl Çayır studierte Geschichte und Philosophie an der Universität zu Köln und ist als freier Forscher tätig. Çayır ist Autor von „Runen in Eurasien. Über die apokalyptische Spirale zum Vergleich der alttürkischen und ‚germanischen‘ Schrift‘“ und ist Gründer der Kultur-Akademie Çayır auf YouTube. Seine Arbeiten wurden international in verschiedenen Fach- und Massenmedien veröffentlicht.
Çağıl Çayır studierte Geschichte und Philosophie an der Universität zu Köln und ist als freier Forscher tätig. Çayır ist Autor von „Runen in Eurasien. Über die apokalyptische Spirale zum Vergleich der alttürkischen und ‚germanischen‘ Schrift‘“ und ist Gründer der Kultur-Akademie Çayır auf YouTube. Seine Arbeiten wurden international in verschiedenen Fach- und Massenmedien veröffentlicht.
AUCH INTERESSANT
– Geschichtswissenschaft –
Ibn Rushd: Der Philosoph, der Islam und Wissenschaft vereinte
In einer Zeit, in der religiöse Dogmen oft als Feinde der Wissenschaft dargestellt werden, wirkt der andalusisch-muslimische Philosoph Ibn Rushd wie eine leuchtende Ausnahmefigur.
Ibn Rushd: Der Philosoph, der Islam und Wissenschaft vereinte